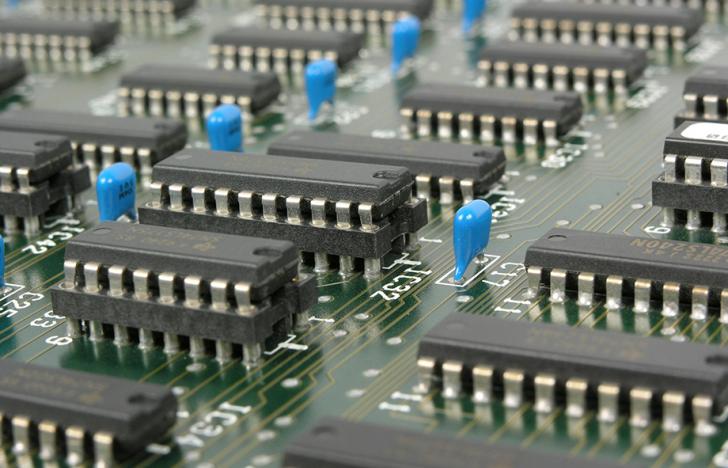Bürger machen Staat 2.0
 privat
privatPhilipp Müller: „Durch Government 2.0 verliert der Staat sein Monopol auf Erstellung des Gemeinwohls. Entziehen kann er sich dem nicht. Wenn er nicht mitmacht, machen die Bürger es allein“, erklärt der Direktor für Public Management und Governance an der Salzburg Business School.
Bisher ist die Kommunikation zwischen Bürger und Staat großteils über die Massenmedien verlaufen. Die Technologie des Web 2.0 verändert die Art und Weise, wie in Zukunft Verwaltung und Politik passieren wird, drastisch. Der Bürger hat nun viel mehr Chancen, seine Meinung kundzutun. Denn im Web 2.0 kann jeder mit jedem kommunizieren. Nicht nur das, über offene Wertschöpfungsketten kann er auch immer öfter an Verwaltung und Politik andocken und mitarbeiten und -entscheiden. Für den Staat bedeutet das einerseits viele helfende Hände für Aufgaben, die er sonst nur schwer finanzieren könnte. Andererseits verliert er an Macht, und der Bürger gewinnt an Einfluss.
economy: Herr Müller, was ist Government 2.0?
Philipp Müller: Zunächst einmal, was ist es nicht: Es ist nicht einfach der Bürgermeister, der sich schnell einmal einen Account bei Facebook oder Twitter zulegt. Es ist auch nicht zum hundertsten Mal das Thema Bürgerbeteiligung, diesmal eben in einer digitalisierten Variante. Es ist viel mehr: Es ist ein neues strategisches Instrument beziehungsweise eine neue Form der Staatskunst – ermöglicht durch die Technologie des Web 2.0. Diese Technologie wird Gesellschaft, Politik und Wirtschaft genauso drastisch verändern wie die Technologie des Buchdrucks. Der Staat wird dann nicht mehr für den Bürger, sondern mit dem Bürger entscheiden.
Inwiefern verändert die Technologie des Web 2.0 die Staatskunst?
Der Staat stützt sich derzeit in der Kommunikation mit dem Bürger vor allem auf die Massenmedien: Wenige Sprecher erreichen damit viele Zuhörer. Im Web 2.0 dagegen kann jeder mit jedem sprechen. Und im Web 2.0 eröffnen sich auch neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Es ermöglicht die verstärkte Nutzung offener Wertschöpfungsketten. Die gab es bisher auch, aber nur in einem sehr eingeschränkten Umfang, etwa wenn sich Eltern an der Verwaltung eines Kindergartens beteiligten. Offene Wertschöpfungsketten kennen wir auch aus der Wirtschaft, wenn etwa ein Autohersteller seine Kunden fragt, wie sie sich ihr nächstes Auto vorstellen und diese Wünsche in die Planung einfließen lässt. Government 2.0 aber ermöglicht durch seine digitalen Werkzeuge das Öffnen von wesentlich mehr Schnittstellen, an denen die Bürger an die Verwaltung und Politik andocken und mitreden, mitentscheiden und mitarbeiten können.
Wie Sie ja sagten, diese offenen Wertschöpfungsketten gibt es bereits. Was ist nun das Neue daran?
Anfang des 20. Jahrhunderts war die von Weber beschriebene Hierarchie die effizienteste Art, öffentliche Wohlfahrt bereitzustellen. Wir zahlen Steuern, damit werden Straßen gebaut oder Krankenhäuser betrieben. Diese öffentlichen Aufgaben werden von der Verwaltung wahrgenommen, die ihre Vorgaben wiederum von den politischen Entscheidungsträgern erhält. Je besser die Politik entscheidet und je besser die Verwaltung umsetzt, umso mehr Leistungen erhalten wir für unsere Steuern. Dabei ermöglicht die klar strukturierte Hierarchie mit ihren eindeutig zugeordneten Verantwortlichkeiten effiziente Verwaltung. Die Bürger wurden da zwar auch bisher immer wieder direkt miteinbezogen, etwa durch eine Volksabstimmung. Diese Formen der Partizipation sind aber kostenintensiv und erfordern einen hohen organisatorischen Aufwand. Die Werkzeuge, die uns das Web 2.0 zur Verfügung stellt, sind dagegen kostengünstig, und sie sind einfach in der Anwendung. Das ist der entscheidende Unterschied: Mit dem Web 2.0 können externe Akteure mit wenig Aufwand eingebunden werden.
Wer nimmt an so einer offenen Wertschöpfungskette teil?
Das sind folgende, sich teils überschneidende Gruppen: Experten, die ihr Fachwissen unentgeltlich zur Verfügung stellen, ähnlich wie das heute auch ein Experte tut, der sich von einer Zeitung interviewen lässt. Dann Bürger, die so etwas wie lokale Experten sind. Die wissen beispielsweise, wo in den Straßen die größten Schlaglöcher sind oder wo es im öffentlichen Raum zu Sachbeschädigungen gekommen ist. Die dritte Gruppe sind die Bürger als Betroffene, ihre Teilnahme sichert die Legitimität eines politischen oder eines Verwaltungsprozesses. Und zuletzt die sogenannten Crowds oder Massen; die erledigen unentgeltlich kleine, für sich betrachtet anspruchslose Aufgaben, die aber in ihrer Summe wichtig für das Gemeinwohl sind und sonst kaum finanzierbar wären.
Was könnten diese Massen so Bemerkenswertes leisten?
Mit Crowd Sourcing kann man tatsächlich Beachtliches erreichen. So hat der Guardian 2009 eine Website ins Leben gerufen, auf der die Bürger innerhalb weniger Monate über 220.000 Spesenbelege ihrer Abgeordneten überprüft haben. Das ist eine ganz wesentliche Kontrollfunktion, die sonst zu vertretbaren Kosten nur stichprobenartig durchgeführt werden könnte.
Zu einer anderen dieser vier Gruppen: Warum ist es nötig, durch Bürgerbeteiligung zusätzlich Legitimität herzustellen? Unsere Institutionen sollten doch schon hinreichend legitimiert sein?
Die Moderne war tatsächlich von einem starken Bewusstsein für Rechtsstaatlichkeit und staatliche Institutionen geprägt. In den letzten 30 Jahren hat aber die Postmoderne eine Skepsis gegenüber absoluten Wahrheiten und damit auch eine institutionelle Vertrauenskrise gebracht. Die Legitimität der Institutionen, die früher vorausgesetzt wurde, erschließt sich den Bürgern heute erst, wenn sie das Ergebnis ihrer Arbeit sehen. Die Bürger bewerten also Verwaltung und Politik nach ihrer Wirkung. Das Vertrauen der Bürger in Politik und Verwaltung gilt damit heute immer nur im Einzelfall.
Man lässt also den Bürger mitreden, zeigt so, dass man ihn ernst nimmt, und erwirbt dadurch sein Vertrauen.
Auch dadurch. Insgesamt zieht der Bürger sich zunehmend darauf zurück, was er erfühlen kann. Und das ist die Frage, ob er dem staatlichen Repräsentanten, der den jeweiligen Prozess managt, Vertrauen entgegenbringen kann. Damit wird authentische Kommunikation zum entscheidenden Faktor.
Wie authentisch kommunizieren heute die Repräsentanten des Staates?
Einzelne haben das immer schon gelebt. Im Moment erleben wir aber einen rasanten Kulturwandel hin zu einer offenen, hemdsärmeligen Weise, Politik und Verwaltung zu machen. Für die strategischen Entscheidungsträger wird es immer wichtiger, neue Formen von Schnittstellen zu den Bürgern zu entwickeln. Das ist in unserem juristisch geprägten System nicht einfach. Für den Einzelnen heißt es, locker zu sein, schnell Beziehungen aufzubauen und damit eine gute Gesprächsgrundlage zu schaffen.
Wie kann man im Web 2.0 authentisch auftreten?
Das ist natürlich eine Herausforderung. Als Handlungsanweisung formuliert: Lagert eure Kommunikation mit dem Bürger nicht an die PR-Abteilung aus – wenn ihr auf Facebook seid, dann schreibt eure Einträge selbst. Wenn ihr twittert, dann twittert selbst. Ich selbst biete in meinen offiziellen E-Mails einen Link zu meinem privaten Picasa-Webalbum an. Die strategische Idee dahinter ist, dass ich schneller Vertrauen aufbauen kann, wenn mein Gegenüber besser einschätzen kann, mit wem er es zu tun hat.
Damit wird das hohe Gut der Privatsphäre gegen den geldwerten Vorteil, durch glaubwürdiges Auftreten erfolgreich in der Karriere zu sein, getauscht.
Glaubwürdigkeit ist für Sie etwa kein hohes Gut? Und die Privatsphäre ist auch kein unumstößlicher Wert. Sie ist ein Kind der Moderne. Die Moderne hat uns diese Binaritäten wie privat und öffentlich, Arbeit und Freizeit, Staat und Wirtschaft, Wohlfühlen und Geldverdienen gebracht. Das Web 2.0 weicht diese scharfen Gegensätze nun wieder auf. Dabei stellt sich uns nicht mehr die Frage, ob wir das wollen – die richtige Frage lautet: Wie gehen wir damit um?
Der mündige Mensch ist gefordert.
Genau. Wer im Web 2.0 auftritt, braucht eine sehr klare Vorstellung davon, wie viel er von sich hergeben will und welche Konsequenzen das möglicherweise haben kann. Und es darf natürlich keinen Zwang geben, ein defensiver Ansatz muss genauso erlaubt sein wie ein offensiver.
Wird das Web 2.0 unser Verständnis von Staatlichkeit verändern?
Das Web 2.0 krempelt unsere Lebenswelt vollkommen um. Bedenken Sie, was diese Technologie in anderen Teilen unserer Gesellschaft bewirkt hat. Es gibt etwa ein Reisebürosterben, weil Webseiten einen großen Teil von deren Leistungen ersetzt haben. Die Musikindustrie, die Medienbranche und das Verlagswesen kämpfen gleichfalls mit Schwierigkeiten. Ebenso müssen wir an den Universitäten uns fragen, inwiefern wir noch relevant sind, welche Bereiche wir in Zukunft dem Web 2.0 überlassen müssen, aber auch, wie wir das Web 2.0 zu unserem Vorteil nutzen können. Und genau diese Fragen müssen sich auch Politik und Verwaltung stellen. Den Staat wird es immer geben, die Frage ist: Wie viel Staat wird es in Zukunft geben?
Der Staat verliert also an Macht und Einfluss.
Staatlichkeit hat sich im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder verändert – einmal war sie wichtiger, dann weniger. Am Ende des 20. Jahrhunderts haben wir einen Höhepunkt erreicht: Niemals zuvor hat der Staat so viel vom erwirtschafteten Bruttosozialprodukt ausgegeben. Und an diesem Punkt kommt es nun zu einer Zäsur, der Staat verliert sein Monopol auf die Erstellung der öffentlichen Wohlfahrt. Weil die Web 2.0-Technologie Zusammenarbeit im Internet auf so kostengünstige und einfache Weise ermöglicht, können das andere jetzt auch. Sehen wir es positiv: Jetzt gibt es noch Handlungsspielräume, die Institutionen können ihre Zukunft noch mitgestalten. Und ich habe ja Beispiele genannt, wie der Staat die Energien und Fähigkeiten seiner Bürger nützen kann, um Aufgaben zu erledigen, die sonst sein Budget belasten oder einfach liegen bleiben. Es sollte auch nicht darum gehen, wer Macht gewinnt oder verliert, sondern wie wir maximalen öffentlichen Nutzen generieren können.
Wie soll der Staat auf diese Situation reagieren?
Der Staat muss sich ein neues Selbstverständnis zulegen. Er sollte sich in Zukunft als Manager der offenen Wertschöpfungsketten verstehen. Das ist übrigens auch eine Rolle, die mit sehr viel Einfluss verbunden ist.
Was muss dieser Manager können?
Zuerst muss er seine Prozesse transparent strukturieren, damit sie nachvollziehbar sind. Das dient der Legitimation dieser Prozesse. Dann muss er sicherstellen, dass die Bürger ohne Schwierigkeiten an den Prozess andocken können und sie zum Mitmachen animieren. Die Rolle des Animateurs wird eine sehr gewichtige Aufgabe sein, denn je mehr Menschen teilnehmen, desto höher ist die Legitimität des Ergebnisses. Daher müssen wir es für den Bürger auch immer spannend machen, wenn wir eine offene Schnittstelle zu ihm generieren.
Wie groß ist die Akzeptanz der Bürger?
In absoluten Zahlen nehmen einige Tausend Bürger an großen Projekten teil. In Prozent ausgedrückt ist das aber weniger beeindruckend, da bewegen wir uns im niedrigen einstelligen Bereich. Wir haben da dieselben Probleme wie in Vorinternetzeiten, auch da wurden Partizipationsrechte oft nicht ausreichend wahrgenommen.
Und besteht nicht auch die Gefahr, dass sich etwa die gebildeten Teile der Bevölkerung mehr als andere in den offenen Wertschöpfungsketten engagieren und das Ergebnis dann nicht die Interessenlage der Gesamtbevölkerung widerspiegelt?
Wir haben festgestellt, dass es bei neuer Technologie immer eine erste Usergruppe gibt, die nur einen sehr kleinen Teil der Gesellschaft abbildet. Das sind fast ausschließlich junge Männer aus den sogenannten heilen Familien, die über eine höhere Ausbildung verfügen. Das normalisiert sich aber im Laufe weniger Jahre, und die Nutzer der Technologie sind dann für die Gesamtbevölkerung repräsentativ. Damit ist eine wichtige Voraussetzung für die proportionale Vertretung bei Meinungsbildungs- und Bürgerbeteiligungsprozessen im Internet gegeben. Andererseits, wenn wir einen Blick zurück in die europäische Geschichte des 17. bis 19. Jahrhunderts werfen, haben immer wieder kleine Gruppen den gesellschaftlichen Diskurs strukturiert und damit in ihrem Sinn gelenkt. Diese Gefahr besteht also durchaus. Letztlich muss gesagt werden, dass wir ganz am Anfang der Ära des Web 2.0 stehen. Es ist noch nicht klar, in welche Richtung wir uns entwickeln werden. Offensichtlich ist heute nur die große Bedeutung dieser Technologie.
Im Web gibt es ja auch nicht wenige sinnfreie Zonen. Wie kann man den Bürger angesichts der vielen Ablenkungsmöglichkeiten zur sinnvollen Mitarbeit anregen?
Vielleicht braucht es eine Art Alphabetisierungskampagne, vielleicht sollten wir den Bürgern zeigen, wie sie die Neuen Medien sinnstiftend nützen können – in ihrem und im Interesse der Allgemeinheit. Andererseits – denken Sie nur an Projekte wie Wikipedia – zeigt das Internet als Gesamtheit seiner Nutzer eine hohe Fähigkeit zur Selbstorganisation und sehr, sehr viel Eigeninitiative. Vielleicht reicht es also auch, wenn der Staat die Entwicklung einfach beobachtet und nur bei bedenklichen Auswüchsen eingreift.
Nennen Sie mir bitte noch ein Beispiel, das zeigt, wie eine offene Wertschöpfungskette funktioniert.
Das wäre etwa das Modell Bürgerbeteiligungshaushalt – es kommt in der Originalform aus Brasilien. In den 90er Jahren wurde es in einer nicht digitalen Form in Städten wie Porto Alegre als radikaldemokratisches Experiment aus der Taufe gehoben. Den Bürgern wird einfach ein Teil des kommunalen Budgets zur Verfügung gestellt, und sie können selbst entscheiden, wie diese Mittel verwendet werden. Ein Ziel dabei ist, die Legitimität zu steigern. Andererseits wird damit auch die Kapazität erhöht, indem der Verwaltungsaufwand reduziert wird – damit kann also mehr Geld in die Projekte selbst fließen.
Gibt es auch in Österreich schon Bürgerbeteiligungshaushalte?
Nein. Aber in Deutschland wurde das Modell in einer abgemilderten Variante von Städten wie Köln, Hamburg, Berlin Lichtenfels oder Erfurt aufgegriffen. Die Bürger entscheiden nicht allein, sie entscheiden mit. Im Gegensatz zu Brasilien passiert das im Web 2.0.
Was wird da entschieden?
Da geht es nicht unbedingt um große Politik, manch einer wird es vielleicht als Kleinkram abtun. In Erfurt beispielsweise wurden mit den Mitteln, die im Rahmen des Bürgerbeteiligungshaushaltes zur Verfügung standen, zusätzliche öffentliche Toiletten errichtet. Aber das war eben das Ergebnis, das wollten die Bürger.
Meine Schlussfrage: Was passiert aber, wenn die Institutionen sich querlegen, wenn sie nur den Machtverlust sehen, der ihnen Government 2.0 bringt?
Government 2.0 funktioniert auf zwei Ebenen, innerhalb der staatlichen Institutionen und außerhalb. Wenn die Institution nicht mitmachen will, dann machen es die Bürger eben allein, etwa als eine private Initiative, die in einer Stadt Straßenschäden dokumentiert. Damit wird diese Stadt im schlimmsten Fall eine Getriebene, die sich ständig ihre Versäumnisse vorwerfen lassen muss. Das ist keine echte Alternative zu kooperativem Handeln.